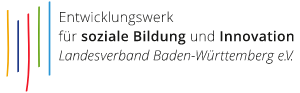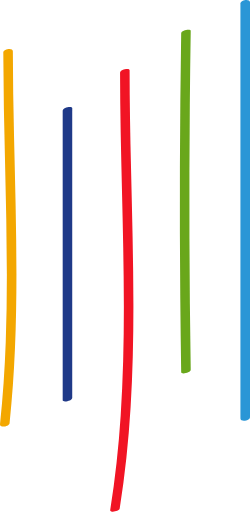Wissen
Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung
Eröffnen Sie neue Karriereperspektiven mit dem Entwicklungswerk: Karrierechancen für pädagogische Hilfskräfte und Quereinsteiger

Empowerment
Die unverzichtbare Rolle der MSO in der Integrationsarbeit
Migrantenselbstorganisationen: Die Brücken zwischen den Migrantengemeinschaften und der Mehrheitsgesellschaft

Pflege
Sozialintegration von ausländischen Pflegekräften
Integration ausländischer Pflegekräfte als Lösung zur Fachkräftesicherung im Pflegebereich

Beraten
Beratung und interkulturelles Projektmanagement
Interkulturalität und Internationalität als Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Projektarbeit im Zeitalter der Globalisierung und Migration

Raum
Veranstaltungen, Workshops und Seminare
Ihre ideale Wahl für geräumige und gemütliche Seminar- und Schulungsräume im Zentrum von Stuttgart-Vaihingen.
Gesellschaftswichtige Herausforderungen mit innovativen Konzepte gemeinsam lösen
„Entwicklung“ steht für „das Vorwärtsschreiten in einem Prozess“, „den Reifefortgang eines Menschen“, „Bildung und Entstehung“ sowie „die Verbesserung und die Schaffung von Dingen oder Sachverhalten“.
All diese Definitionen vereint das Entwicklungswerk für soziale Bildung und Innovation in seinen Leistungen und setzt sich so in der Lösung gesellschaftlich wichtiger Herausforderungen für Menschen, Unternehmen, Kommunen sowie Organisationen ein.
Unsere Leistungen und Kompetenzen
Ausbildung und Beruf
Das Entwicklungswerk bietet als Träger der Carola-Blume Schule die Möglichkeit zur gezielten Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung zum/r Erzieher/in.
Niederschwellige Unterstützungsangebote
Da die Menschen immer länger leben und der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft steigt, wächst der Bedarf an Unterstützungsangeboten in Vor- und Umfeld von Pflege.
Empowerment von MSO
Migrantenselbstorganisationen zählen zu den wichtigen Akteuren der Zivilgesellschaft und sind ernstzunehmende Partnerinnen von Kommunen und Landkreisen.
Pflege
Pflegekraft in Deutschland werden
Das Entwicklungswerk verfolgt mit dem sozialintegrativen Ansatz genau dieses Ziel. Den angeworbenen Pflegekräften (Bachelor of Nursing) sowie Auszubildenden wird nicht nur eine Arbeitsperspektive in Deutschland geboten, sondern sie werden auch bei der sozialen Integration in ihrem neuen Lebensumfeld begleitet. Der Länderfokus liegt hierbei auf der Türkei.
Aktuelle Projekte vom Entwicklungswerk
Engagement
Pflegekraft in Deutschland werden
Du liebst es, für Andere da zu sein, möchtest mit Menschen arbeiten und Gutes tun? Das Sozial- und Gesundheitswesen bietet abwechslungsreiche und vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten mit guten Aufstiegschancen. Bei uns sind engagierte Fachkräfte nicht nur gefragt, sondern vor allem auch gesucht.